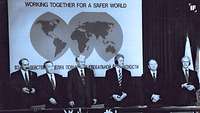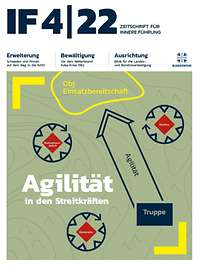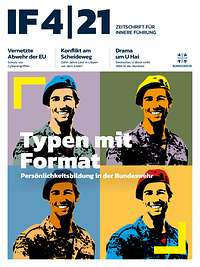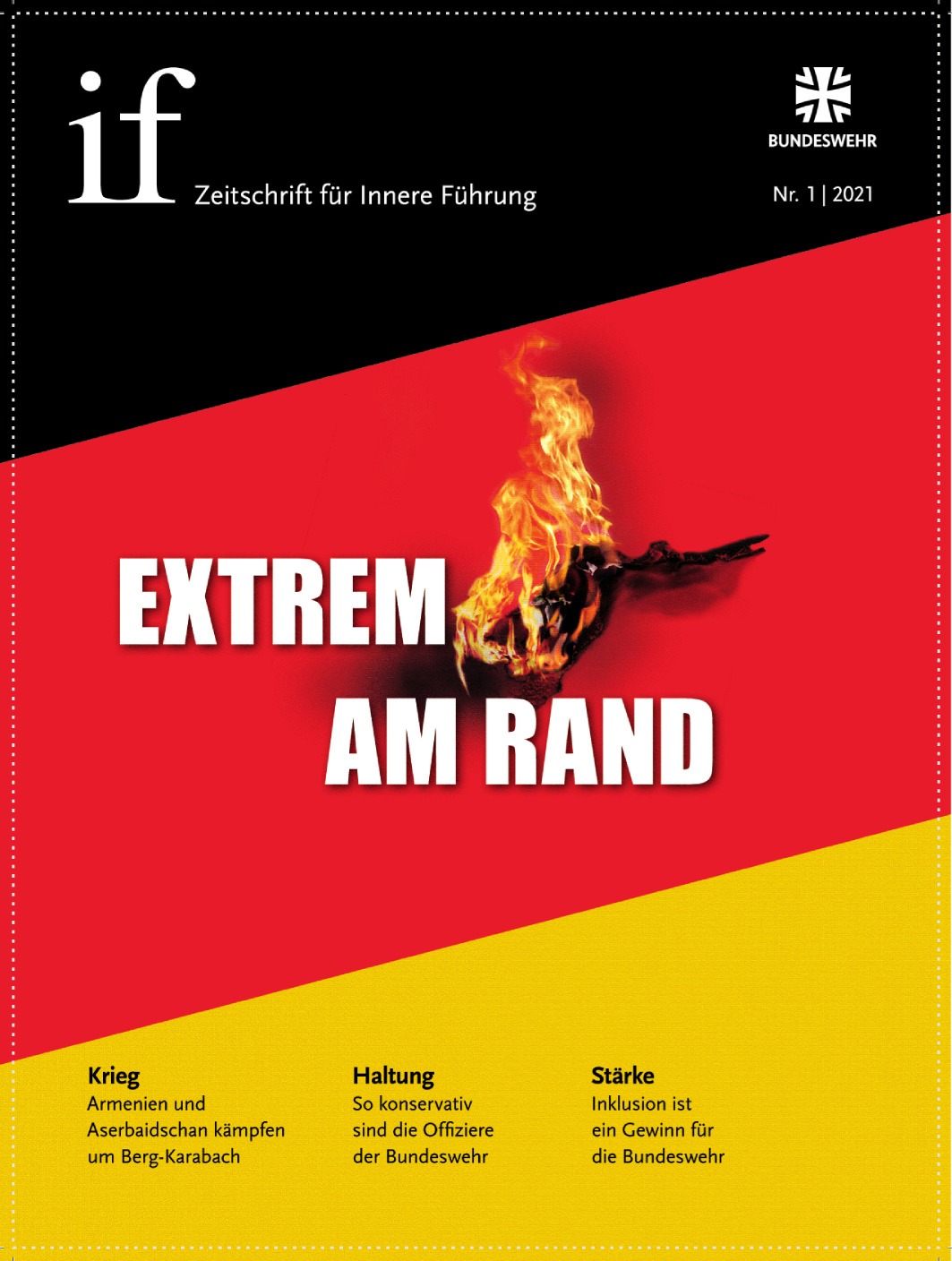Von der Einsatzarmee zur Landes- und Bündnisverteidigung
Von der Einsatzarmee zur Landes- und Bündnisverteidigung
- Datum:
- Ort:
- Koblenz
- Lesedauer:
- 7 MIN
Der Beginn des brutalen völkerrechtswidrigen Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine am 24. Februar dieses Jahres war mehr als nur ein Weckruf. Er markiert den bisherigen Höhepunkt einer Entwicklung, die bereits viel früher begann. Die Welt hat sich nicht erst seit diesem Datum dramatisch verändert.
Die Vorboten waren unter anderem bereits im zweiten Tschetschenienkrieg (1999 ff.), dem Krieg in Georgien (2008), in der Annexion der Krim und der russischen Unterstützung der Separatisten im Donbass (2014) sowie in der russischen Militärintervention in Syrien seit 2015 erkennbar.
Spätestens seit 2014 wurde endgültig deutlich, dass Russland grundsätzlich bereit war, sich zur Durchsetzung seiner außenpolitischen Ziele über völkerrechtliche Verträge und Vereinbarungen hinwegzusetzen und, falls aus eigener Lageeinschätzung notwendig und vor dem Hintergrund eigener Risiko- Nutzen-Kalkulation umsetzbar, auch militärische Gewalt einzusetzen. Das Weißbuch der Bundesregierung aus dem Jahr 2016 traf dazu bereits die deutliche Feststellung, dass Russland die europäische Friedensordnung offen in Frage stelle und dies tiefgreifende Folgen auch für die Sicherheit Deutschlands habe.
Als Folge war bereits damals der Beginn der Zerstörung der bis dahin seit 1945 gemeinsam geschaffenen kooperativen Sicherheitsordnung – nicht nur für uns – in Europa erkennbar, die neben anderem auf den folgenden Dokumenten ruhte:
- Der Charta der Vereinten Nationen vom 26. Juni 1945, Art. 2, Abs. 4,
- der KSZE-Schlussakte von Helsinki vom 1. August 1975,
- der Charta von Paris für ein neues Europa vom 21. November 1990,
- dem Budapester Memorandum vom 5. Dezember 1994 und
- der Grundakte über gegenseitige Beziehungen, Zusammenarbeit und Sicherheit zwischen der Nordatlantikvertrags-Organisation und der Russischen Föderation vom 27. Mai 1997.
All diese völkerrechtlichen Vereinbarungen, die schon seit 2014 in Frage gestellt worden waren, wurden am 24. Februar dieses Jahres sozusagen über Nacht nahezu bedeutungslos.
Stattdessen, da sind sich die meisten politischen Beobachter einig, werden wir künftig – für die nächsten ein bis zwei Dekaden!? – eine stärker konfrontativ ausgerichtete europäische Sicherheitsordnung vor uns haben, die aller Voraussicht nach auf militärischer Abschreckung gründen und zunächst auf die Eindämmung russischer imperialistischer Politikansätze ausgerichtet sein wird.
Dazu stellte Bundeskanzler Olaf Scholz in seiner Regierungserklärung am 27. Februar 2022 im Deutschen Bundestag fest: „Wir erleben eine Zeitenwende. Und das bedeutet: Die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor. Im Kern geht es um die Frage, ob Macht das Recht brechen darf, ob wir es Putin gestatten, die Uhren zurückzudrehen in die Zeit der Großmächte des 19. Jahrhunderts oder ob wir die Kraft aufbringen, Kriegstreibern wie Putin Grenzen zu setzen.“
Zusätzlich kündigte er an, per Sondervermögen in Höhe von 100 Mrd. Euro und mit Verteidigungsausgaben von mehr als 2% des Bruttoinlandsproduktes (BIPBruttoinlandsprodukt) die Ausrüstung undAusstattung der Bundeswehr und damit die Verteidigungsfähigkeit zu stärken. Obwohl eine solche Entscheidung eigentlich schon lange überfällig war, scheint sie noch nicht endgültig abgesichert. Denn Diskussionen im politischen Berlin zeigen, dass bezogen auf diese Summe bereits Begehrlichkeiten aus anderen Bereichen geweckt sind, die mit dem harten Kern militärischer Sicherheit und Abschreckung weniger zu tun haben. Daher sollte diesen Bestrebungen politisch ein klares „Halt!“ entgegengesetzt werden.
Zusätzliches Budget
An all dies knüpfen sich eine Reihe von Fragen, die sich auf die Bundeswehr sowie die Auswirkungen auf diese beziehen: Reicht das zusätzliche Geld zum Herstellen der vollen materiellen Einsatzbereitschaft der gesamten Bundeswehr für die Bündnis- und Landesverteidigung aus?
Der tatsächliche Finanzbedarf dürfte derzeit bei deutlich jenseits von 200 Milliarden Euro liegen.
Dass die Bundeswehr im Vergleich zu anderen Armeen bezogen auf ihre in großen Teilen überalterte Ausstattung nicht auf Rosen gebettet war und ihre Beschaffungsvorhaben chronisch unterfinanziert waren, ist seit längerer Zeit allen politischen Entscheidungsträgern bekannt. Im Jahr 2018 berechnete das Verteidigungsministerium, „wie groß der Finanzbedarf für eine angemessene Ausstattung der Bundeswehr tatsächlich ist: Mindestens 200 Milliarden Euro. Davon allein 130 Milliarden Euro für neue Kampfpanzer und Schiffe. Weitere 70 Milliarden Euro kämen hinzu, wenn Luftwaffe und Marine ihre jeweiligen Flotten modernisieren würden.“ Das heißt, der tatsächliche Finanzbedarf dürfte damit derzeit bei deutlich jenseits der 200 Milliarden Euro liegen. Dies sind Fakten, die die militärische Führung heute – bei aller Genugtuung oder Freude über das angekündigte „Sondervermögen“ – schonungslos deutlich auf den Tisch legen muss. Denn da die Summe zusätzlichen Geldes zumindest kurz- und mittelfristig objektiv nicht ausreicht, gilt es eine kluge Balance zwischen dem erforderlichen zeitnahen Füllen hohler Strukturen einerseits und notwendigen Neuanschaffungen andererseits zu finden. Das Füllen hohler Strukturen ist unabdingbar erforderlich. Zum einen, um die materielle Einsatzbereitschaft wieder herzustellen, zum zweiten, um die erforderliche Ausbildung zur Wiederherstellung der vollen Einsatzbereitschaft zu gewährleisten, und zum dritten, um die berechtigte Erwartungshaltung der Truppe zu befriedigen und somit einen Beitrag dazu zu leisten, dass das angeschlagene Vertrauen in die militärische und politische Führung wieder gestärkt wird.
Beschaffung verbessern
Kann die derzeitige Beschaffungsorganisation der Bundeswehr das „Sondervermögen“ schnell und gezielt in eine volle materielle Einsatzbereitschaft für die Bündnis- und Landesverteidigung umsetzen?
Dazu müssen ebenso schonungslos die bisherigen Probleme in der Beschaffungsorganisation der Bundeswehr auf den Tisch, damit die Wirkung des „Sondervermögens“ nicht „verpufft“. Es ist im Vergleich nicht länger hinnehmbar, dass scheinbar „effizientere Abläufe im Einkauf in anderen europäischen NATONorth Atlantic Treaty Organization-Ländern dazu geführt haben, dass ihre Armeen mehr in die Ausrüstung ihrer Soldaten investieren konnten als die Bundeswehr.“ Es sollte noch einmal völlig unvoreingenommen untersucht werden, ob eine moderne Beschaffungsorganisation, die sich an Vorbildern aus Wirtschaft und Industrie orientiert, nicht doch besser Abhilfe schaffen könnte.
Einsatzbereitschaft stärken
Wird die derzeitige Bundeswehrstruktur den Erfordernissen einer vollen Einsatzbereitschaft für die Bündnis- und Landesverteidigung gerecht?
Daneben muss aber auch zwingend die heutige Struktur der bisher kleinsten Bundeswehr mit der höchsten Anzahl an Stäben, die insgesamt zu kopflastig ist und zu viele Schnittstellen beinhaltet und die damit die eindeutige Zuordnung und Wahrnehmung von Verantwortung erschwert, einer gründlichen .berprüfung unterzogen werden. Untersuchungen dazu und entsprechende Vorschläge lagen seit einiger Zeit – auch im Verteidigungsministerium – auf dem Tisch.
Außerdem wurde im Koalitionsvertrag der jetzigen Regierung vereinbart: Die Strukturen der Bundeswehr müssen effektiver und effizienter gestaltet werden mit dem Ziel, die Einsatzbereitschaft zu erhöhen. Dazu unterziehen wir Personal, Material und Finanzen einer kritischen Bestandsaufnahme. Daraufhin hatte die neu ins Amt gekommene Verteidigungsministerin Christine Lambrecht erneut eine grundlegende Bestandsaufnahme von Bundeswehrstruktur und Einsatzbereitschaft, einschließlich eines Vorschlages zum weiteren Vorgehen, bis zum Juni 2022 angeordnet. Da in diesem Gesamtzusammenhang nach der Arbeit einer Vielzahl von Kommissionen und Workshops der letzten Jahre bezüglich der derzeitigen Strukturdefizite kein Erkenntnisproblem, sondern eher ein Umsetzungsproblem besteht, ist zu hoffen, dass jetzt endlich gehandelt wird. Die Truppe, die immer wieder Bestandsaufnahmen, Schlussfolgerungen, aber nur wenig Fortschritte erlebte, erwartet dies nun auch zu Recht.
Bündnis- und Landesverteidigung als Ziel
Umfasst die Wiederherstellung der vollen Einsatzbereitschaft für die Bündnis- und Landesverteidigung mehr als nur die Beschaffung von Material und Ausrüstung?
Diese Frage ist eindeutig mit ja zu beantworten. Dazu ist aber zunächst einmal eine stringente Kommunikationsstrategie erforderlich, da der notwendige Wandel alle Bundeswehrangehörigen – zivil und militärisch – betreffen wird. Dabei ist deutlich herauszustellen, dass es um das Wiederherstellen der vollen Einsatzbereitschaft für die Bündnis- und Landesverteidigung geht. Denn es ist ja nicht so, dass die Angehörigen nicht einsatzbereit wären oder bisher in der Wahrnehmung ihrer Aufgaben und Aufträge keine Einsatzbereitschaft gezeigt hätten. Im Gegenteil! Sie haben sich trotz einer bereits seit Jahren anhaltenden Überdehnung der verfügbaren Kräfte durch hohe Motivation, sehr gute Fachlichkeit und überdurchschnittliche Leistungen sowohl national als auch international große Anerkennung erworben. Die erforderlichen Ergänzungen in der Ausbildung werden sowohl das berufliche/soldatische Selbstverständnis als auch ein den neuen Realitäten gerecht werdendes dynamisches Mindset umfassen müssen. Zusätzlich werden Führen, Ausbilden und Erziehen (im Sinne von Charakterbildung und Prägung) und alle anderen Handlungsfelder der Inneren Führung Hochkonjunktur haben. Dabei muss deutlich werden, dass alle Maßnahmen des Konzeptes der Inneren Führung insgesamt letztendlich auf das Herstellen der Einsatzbereitschaft ausgerichtet sind.
Insofern berührt die Zeitenwende die Grundfesten der Bundeswehr.