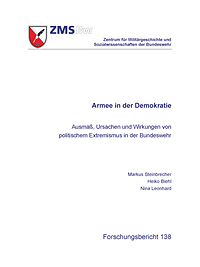Politischer Extremismus: Für die meisten Soldatinnen und Soldaten kein Thema
Rechtsextremistische Vorkommnisse beim Kommando Spezialkräfte der Bundeswehr sorgten 2020 für eine Debatte über politischen Extremismus in den Streitkräften. Die ZMSBwZentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr-Studie „Armee in der Demokratie“ untersucht erstmals dessen Ausmaß und Erscheinungsformen umfassend. Ergebnis: Die Truppe denkt demokratisch und lehnt politischen Extremismus ab.

Die damalige Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hatte die Studie nach den Vorfällen beim KSKKommando Spezialkräfte in Auftrag gegeben, um das Phänomen des politischen Extremismus in den Streitkräften zu beleuchten. Ein Forschungsteam des Zentrums für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr (ZMSBwZentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr) befragte dafür mehr als 4.300 zufällig ausgewählte Bundeswehrangehörige zu ihren politischen Einstellungen – Soldatinnen und Soldaten aller Dienstgrade und Zivilbeschäftigte aller Laufbahngruppen.
Um einen Vergleich zur Gesamtbevölkerung zu haben, wurden auch mehr als 4.600 Bürgerinnen und Bürger um Angaben zu ihren politischen Überzeugungen gebeten. Alle Beteiligten machten freiwillig und anonym bei den repräsentativen Befragungen mit. Zusätzlich wurden auch Gruppendiskussionen mit rund 100 Soldatinnen und Soldaten geführt, um mehr über den Umgang mit Extremismus in den Streitkräften zu erfahren. Da sich vier von fünf Extremismus-Fälle in der Bundeswehr auf den Rechtsextremismus beziehen und in 90 Prozent dieser Fälle Soldatinnen oder Soldaten verdächtig sind, legten die Wissenschaftler ihren Forschungsschwerpunkt auf den Rechtsextremismus unter Uniformträgern.
Bundeswehrangehörige sehen sich politisch in der Mitte
Zunächst sollten sich die Studienteilnehmenden im politischen Links-Rechts-Spektrum positionieren. Mehr als 90 Prozent der Soldatinnen und Soldaten sehen sich ihren Angaben zufolge in der politischen Mitte. 2,6 Prozent der Befragten verorten sich am linken, 2,1 Prozent am rechten Rand des politischen Spektrums. Unter den Zivilbeschäftigten der Bundeswehr und den Bürgerinnen und Bürgern positionierten sich jeweils rund 11 Prozent an den Rändern. Was die politische Selbsteinschätzung angeht, stehen die Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr also genau da, wo sie auch sein sollten: In der Mitte der Gesellschaft.
Auf dem Boden des Grundgesetzes
Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr sind „Staatsbürger in Uniform“: Von ihnen werden die Verteidigung der Werte der Bundesrepublik Deutschland und ein aktives Bekenntnis zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung erwartet. Entsprechend werden die Maximen des Grundgesetzes von einer großen Mehrheit der Uniformierten befürwortet. So wird das Recht auf freie Meinungsäußerung beispielsweise von rund 91 Prozent der Soldatinnen und Soldaten vertreten.
Nur 0,2 Prozent der Uniformierten lehnen die freiheitlich-demokratische Grundordnung ab. Im Vergleich mit der Bevölkerung zeigen Bundeswehrangehörige mehr Interesse an Politik und sind zufriedener mit dem demokratischen System. Die Maßnahmen der Bundeswehr zur politischen Bildung der Soldatinnen und Soldaten zeigen also offensichtlich Wirkung.
Eine große absolute Mehrheit der Soldatinnen und Soldaten und der zivilen Beschäftigten der Bundeswehr wird den Grundsätzen der Inneren Führung und den Anforderungen an eine Armee (in) der Demokratie vollkommen gerecht.
Rechtsextremismus wird abgelehnt
Bestätigt wurde die Annahme, dass sich Menschen mit einer extremistischen Weltanschauung zum Dienst in den Streitkräften und vor allem zum Dienst in Uniform hingezogen fühlen. Allerdings bedeutet dies nicht, dass sie auch in die Bundeswehr gelangen: Bewerberinnen und Bewerber werden vor einer möglichen Einstellung in die Bundeswehr auf eine extremistische Vergangenheit hin geprüft. Zudem sind die Gefahren des Extremismus und der Umgang mit ihm immer wieder Thema in der Ausbildung der Soldatinnen und Soldaten.
Die meisten Angehörigen der Bundeswehr lehnen rechtsextremistische Positionen dezidiert ab und nur ein sehr geringer Teil hat ein geschlossen rechtsextremes Weltbild.
Diese Präventionsmaßnahmen scheinen auch hier zu greifen: Rechtsextremistische Positionen wie die Verharmlosung des Nationalsozialismus, Judenhass oder die Befürwortung einer Diktatur finden kaum Zuspruch in der Truppe. So weisen laut ZMSBwZentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr-Studie etwa 0,4 Prozent der Soldatinnen und Soldaten ein verfestigtes rechtextremes Weltbild auf. In der Durchschnittsbevölkerung liegt dieser Wert bei 5,4 Prozent.
Die Null-Toleranz-Linie der Streitkräfte gegen Extremisten aller Art wird von den Soldatinnen und Soldaten mitgetragen. 96 Prozent sind der Meinung, dass diese nichts in den Streitkräften verloren haben. 91 Prozent wollen, dass Bewerberinnen und Bewerber abgelehnt werden, wenn es Zweifel an deren Verfassungstreue gibt.
Unempfänglich für Verschwörungstheorien
Auch Politikziele der sogenannten Neuen Rechten werden von den Soldatinnen und Soldaten mehrheitlich abgelehnt. Besonders deutlich wird dies bei der Frage nach dem Zuzug von Migranten: rund 15 Prozent der Soldatinnen und Soldaten wollen, dass der Zuzug gestoppt wird. Im Bevölkerungsdurchschnitt fordern dies rund 43 Prozent der Menschen.
Die Bundeswehrangehörigen zeigen zudem eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Verschwörungstheorien und die Thesen der Reichsbürgerszene. Weniger als fünf Prozent der Soldatinnen und Soldaten teilen Ansichten wie zum Beispiel jene, dass die Bundesrepublik Deutschland kein legitimer Staat sei.
Auch das Leugnen des Klimawandels und die Überzeugung, die Corona-Pandemie sei von dunklen Mächten gesteuert worden, finden bei weniger als fünf Prozent der Truppe Resonanz. Im Vergleich dazu zweifeln knapp 15 Prozent der Bevölkerung an, dass der Klimawandel wissenschaftlich belegt ist, und hinter Corona vermuten zwölf Prozent der Bürgerinnen und Bürger eine Verschwörung.

Nur sehr wenige Soldatinnen und Soldaten bekennen sich nicht zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung.
BundeswehrPolitische Unzufriedenheit und Standesdünkel fördern Extremismus
Nur eine kleine Minderheit der Bundeswehrangehörigen neigt also zu extremistischen Positionen. Als einen Erklärungsfaktor macht das Forschungsteam eine grundsätzliche Unzufriedenheit mit dem politischen System Deutschlands aus. Ein weiterer Faktor sei soldatischer Standesdünkel: Wer sich als Teil einer kriegerischen Elite betrachte und für sich eine gesellschaftliche Sonderrolle einfordere, neige eher zu extremistischen Einstellungen. Wer hingegen den Soldatenberuf als Dienst an der Demokratie begreift und hinter dem Konzept der Bundeswehr als Parlamentsarmee steht, sei weniger empfänglich für rechtsextremistische Positionen.
Dienstliche Unzufriedenheit ist hingegen kein Erklärungsfaktor für extremistische Ansichten. 70 Prozent der Bundeswehrangehörigen fühlen sich mit ihrem Arbeitgeber verbunden, stark kritisiert wird hauptsächlich der Zustand von Ausrüstung und Bewaffnung.
Auch die von vielen Soldatinnen und Soldaten empfundene mangelnde Wertschätzung der Bevölkerung hat keinen Einfluss auf die Entwicklung extremistischer Positionen. Auffällig ist der Befund, dass nur elf Prozent der Uniformierten glauben, dass die Bevölkerung hinter der Bundeswehr steht – während gleichzeitig die Hälfte der befragten Bürgerinnen und Bürgern angeben, die deutschen Streitkräfte zu unterstützen.
Dies deckt sich mit den Ergebnissen der Bevölkerungsumfrage des ZMSBwZentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr, wonach sogar neun von zehn Bürgerinnen und Bürgern die Bundeswehr unterstützen. Der von vielen Uniformierten gewünschte Rückhalt der Bevölkerung für die Bundeswehr sei da, konstatiert das ZMSBwZentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr-Forschungsteam. Umso wichtiger sei es, dem Extremismus in den Streitkräften konsequent entgegenzutreten, um das Ansehen der Bundeswehr in der Gesellschaft nicht zu gefährden.
von Timo Kather