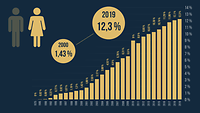Nach der Kapitulation der deutschen Wehrmacht im Mai 1945 war die Gründung einer Bundeswehr noch in weiter Ferne. Die Alliierten Frankreich, Großbritannien und USA im Westen sowie die UdSSRUnion der Sozialistischen Sowjetrepubliken im Osten leiteten die Entwaffnung ein: Militärische Einheiten wurden aufgelöst, Waffen zerstört oder weggeschafft und Rüstungsbetriebe demontiert. Bis 1947 entstanden 16 Länder, jedoch noch keine zentrale Vertretung Deutschlands. Stattdessen begünstigte der beginnende Kalte Krieg die Staatsgründung der Bundesrepublik Deutschland sowie der DDR und warf auf beiden Seiten die Frage nach der Wiederbewaffnung auf.
Anlässlich des Koreakrieges wurden mit der Himmeroder Denkschrift erste Grundsätze für einen bundesdeutschen Beitrag zu einer europäischen Sicherheitsarchitektur definiert. Dies beinhaltete unter anderem, militärische Verbände als Teil europäischer Streitkräfte unter einem gemeinsamen Kommando, der EVG (Europäische Verteidigungsgemeinschaft), aufzustellen.
Der spätere Verteidigungsminister Theodor Blank verhandelte anschließend im Geheimen mit den Alliierten, die Bundesrepublik mit Streitkräften auszustatten.
Am 6. Mai 1955 wurden gemeinsam mit Großbritannien, Frankreich und den Benelux-Staaten die Pariser Verträgen verhandelt und es kam zur Gründung der Westeuropäischen Union. Anschließend trat Westdeutschland auch der NATONorth Atlantic Treaty Organization bei.
Am 12. November, zum 200. Geburtstag des preußischen Heeresreformers, Generalleutnant Gerhard Johann David von Scharnhorst, kam es dann zur Vereidigung der ersten 101 Soldaten der Bundeswehr – die Gründung der Bundeswehr war besiegelt.